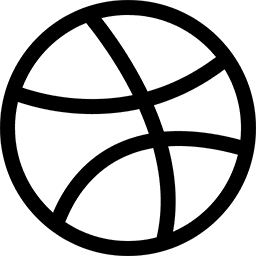Zwickau. Nach einer mutmaßlich politisch motivierten Gewalttat in Dresden-Johannstadt Ende Juli wurde nun ein zweiter Tatverdächtiger in Zwickau festgenommen. Der Vorfall wirft ein grelles Licht auf rechtsextreme Strukturen in Sachsen – und auf die zunehmende Gewaltbereitschaft innerhalb dieser Szene.
Ein brutaler Übergriff mit politischem Hintergrund
Ende Juli 2025 wurde in Dresden ein 18-jähriger junger Mann schwer verletzt, nachdem er von zwei Männern mit einer Glasflasche attackiert worden war. Die Tat ereignete sich in Dresden-Johannstadt – einem Stadtteil, der in den letzten Jahren vermehrt zum Schauplatz gesellschaftlicher Spannungen geworden ist. Der Angriff wurde offenbar aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds des Opfers verübt, das als „linksorientiert“ wahrgenommen wurde. Die Ermittlungen laufen unter dem Verdacht einer politisch motivierten Gewalttat.
Unmittelbar nach der Tat wurde ein 41-jähriger Mann in Tatortnähe festgenommen. Gegen ihn lagen bereits zwei offene Haftbefehle wegen anderer Delikte vor. Nun wurde auch ein zweiter Verdächtiger, ein 36-jähriger Mann, in Zwickau gestellt. Er wurde am 19. August 2025 an seinem Wohnort festgenommen und soll noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Soko Rex übernimmt die Ermittlungen
Die Ermittlungen werden von der „Soko Rex“ geführt, einer Spezialeinheit des Landeskriminalamts Sachsen, die sich auf rechtsextremistisch motivierte Straftaten spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 arbeitet die Einheit an der Aufklärung und Bekämpfung rechtsextremer Netzwerke, Straftaten und Propagandaaktionen. Der aktuelle Fall liegt vollständig in ihrem Zuständigkeitsbereich – nicht zuletzt, weil die beiden Tatverdächtigen bereits dem rechten Milieu zugeordnet wurden.
Was ist die Soko Rex und welche Aufgaben erfüllt sie?
Die Soko Rex wurde ins Leben gerufen, um rechtsextreme Straftaten in Sachsen systematisch zu verfolgen. Mit Außenstellen in Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und Zwickau ist sie flächendeckend aktiv. Zu ihren Aufgaben gehört nicht nur die Aufklärung von Übergriffen, sondern auch die präventive Beobachtung extremistischer Gruppierungen und die Sicherstellung von Propagandamaterial oder Waffen.
Ein Sprecher des LKA Sachsen erklärte in einem früheren Interview: „Wir müssen in Sachsen mit einer besonders organisierten und vernetzten rechten Szene umgehen. Unser Ziel ist es, frühzeitig Strukturen zu erkennen und zu zerschlagen.“
Ein Einzelfall oder strukturelle Gewalt?
Die Gewalttat von Dresden reiht sich ein in eine lange Liste rechtsextremer Übergriffe, die Sachsen seit Jahren erschüttern. Die Zahlen des Bundeskriminalamts und des Verfassungsschutzes zeigen dabei einen beunruhigenden Trend: Im Jahr 2024 wurden bundesweit 1.488 politisch rechts motivierte Gewalttaten registriert – ein Anstieg von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders auffällig ist die Entwicklung in Sachsen, wo das rechtsextreme Personenpotenzial bei etwa 6.000 liegt – mit steigender Tendenz.
Welche Rolle spielt Sachsen innerhalb der rechtsextremen Szene in Deutschland?
Sachsen gilt als ein Zentrum rechter Radikalisierung. Verschiedene Gruppierungen wie die „Elblandrevolte“ oder die „Sächsischen Separatisten“ operieren hier mit hoher Reichweite, insbesondere in sozialen Netzwerken. Die „Elblandrevolte“, eine relativ junge Bewegung, nutzt Plattformen wie TikTok, Telegram und Instagram, um Jugendliche zu radikalisieren. Die Inhalte reichen von harmlos wirkenden Memes bis hin zu offenen Aufrufen zu Gewalt gegen politische Gegner.
Die „Sächsischen Separatisten“ hingegen verfolgen eine deutlich gewalttätigere Linie: Die Gruppe plante unter anderem die Vorbereitung eines „Umsturzes“ mithilfe von Waffen und Sprengstoff. Beide Gruppierungen zeigen exemplarisch, wie sich rechte Ideologien zunehmend professionalisieren – und wie gefährlich sie werden können.
Wie sind die beiden Tatverdächtigen einzuordnen?
Über die genauen Hintergründe der beiden Verdächtigen im aktuellen Fall ist bislang wenig bekannt. Fest steht jedoch: Beide Männer waren bereits polizeilich bekannt, und mindestens einer von ihnen hatte weitere offene Haftbefehle. Beide werden dem rechtsextremen Spektrum zugerechnet. Ob sie Teil organisierter Strukturen sind – etwa lokaler Zellen oder überregionaler Netzwerke – ist Gegenstand laufender Ermittlungen.
Gibt es Parallelen zu früheren Fällen rechter Gewalt?
Ja. Sachsen war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz rechter Gewalt. Die Ausschreitungen in Chemnitz 2018 gelten vielen als Wendepunkt – damals eskalierte die Lage nach dem Tod eines Mannes infolge eines Messerangriffs durch Falschinformationen und massenhafte Mobilisierung über soziale Medien. Es kam zu Hetzjagden auf Migranten, massive Polizeieinsätze folgten. Die Rolle von Telegram und anderen Netzwerken als Brandbeschleuniger ist seither unstrittig.
Wie reagiert die Gesellschaft auf die zunehmende rechte Gewalt?
Deutschlandweit gibt es eine wachsende gesellschaftliche Gegenbewegung. Im Januar 2024 demonstrierten über 900.000 Menschen gegen Rechtsextremismus – auch in Sachsen gingen Tausende auf die Straße. In Dresden wurde unter anderem der sogenannte „Trauermarsch“ rechter Gruppen mit einem bunten Gegenprotest von über 10.000 Menschen begleitet. Zivilgesellschaftliche Initiativen wie „Dresden Nazifrei“ oder das „Kulturbüro Sachsen“ dokumentieren rechte Vorfälle und unterstützen Betroffene.
Wie groß ist das rechtsextremistische Gefahrenpotenzial in Sachsen laut Verfassungsschutz?
Der sächsische Verfassungsschutz schätzt das rechtsextreme Personenpotenzial im Bundesland auf rund 6.000 Personen. Der bundesweite Vergleich zeigt: Sachsen liegt damit an der Spitze der Länder, was organisierte rechte Strukturen angeht. Zudem wurde der Landesverband der AfD 2023 offiziell als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft.
Die Rolle der sozialen Medien – neue Kanäle der Radikalisierung
Ein zentrales Element bei der Entstehung und Verbreitung rechter Gewalt ist die Nutzung digitaler Plattformen. Gruppen wie die „Elblandrevolte“ nutzen TikTok für ästhetisch aufbereitete Clips, die mit rechter Symbolik und populistischen Aussagen junge Menschen ansprechen. Telegram-Gruppen dienen als geschlossene Räume für Radikalisierung, Mobilisierung und sogar operative Planung.
Diese Dynamiken stellen Ermittlungsbehörden vor enorme Herausforderungen. Inhalte verschwinden schnell, werden verschlüsselt weitergegeben oder erreichen junge Zielgruppen, die sich oft außerhalb des klassischen Blickfelds von Polizei und Prävention befinden.
Welche Maßnahmen sind derzeit in Kraft?
Neben der Arbeit der Soko Rex setzen sich auch überregionale Behörden und das Bundeskriminalamt verstärkt mit digitaler Radikalisierung auseinander. Dennoch fordern viele Stimmen eine bessere Ausstattung der Sicherheitsdienste, schnellere Verfahren zur Sperrung extremistischer Inhalte und eine engere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Plattformbetreibern.
Rechtspolitische Diskussionen nehmen Fahrt auf
In Folge der Zunahme rechtsextremer Gewalttaten werden in der Politik verstärkt Forderungen laut, härtere Maßnahmen gegen Extremisten zu ergreifen. Diskutiert werden unter anderem:
- Ausweitung des Waffenverbots auf bekannte rechtsextreme Personen
- Schnellverfahren bei politisch motivierten Gewalttaten
- Bessere finanzielle Ausstattung von Aussteigerprogrammen
- Verstärkte Aufklärung in Schulen und sozialen Einrichtungen
Während Befürworter solcher Maßnahmen schnelles Handeln fordern, warnen Kritiker vor einer Aushöhlung von Grundrechten. Die gesellschaftliche Debatte ist im vollen Gange – und spiegelt die Polarisierung wider, die in Teilen der Bevölkerung spürbar zugenommen hat.
Ein Gesellschaftsproblem mit vielen Gesichtern
Der Fall in Dresden-Johannstadt und die Festnahme in Zwickau stehen exemplarisch für eine Entwicklung, die nicht nur Sachsen betrifft, sondern bundesweit Besorgnis auslöst. Die Kombination aus politisch motivierter Gewalt, digitaler Radikalisierung und der Vernetzung extremistischer Gruppen erfordert eine langfristige, koordinierte Antwort – von Sicherheitsbehörden, Politik und Zivilgesellschaft gleichermaßen.
Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Details die Ermittlungen in den kommenden Wochen ans Licht bringen werden. Klar ist jedoch bereits jetzt: Die Bedrohung durch rechtsextreme Strukturen ist real – und sie wächst. Es braucht eine entschlossene, aber differenzierte Strategie, um dieser Herausforderung auf allen Ebenen zu begegnen.