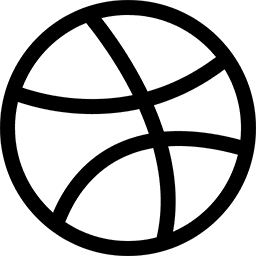Zwickau – Am 2. September erhält die Stadt Zwickau prominenten Besuch: Die Mitwirkenden des preisgekrönten Dokumentarfilms „Das leere Grab“ reisen im Rahmen einer deutschlandweiten Veranstaltungsreihe in die Region. Der Film thematisiert koloniale Gewalt, die bis heute nachwirkt, und gibt Menschen eine Stimme, deren Geschichte jahrzehntelang überhört wurde.
Ein Film, der Geschichte sichtbar macht
„Das leere Grab“ ist ein eindrucksvoller Dokumentarfilm, der sich mit einem dunklen Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte befasst. Im Zentrum stehen zwei tansanische Familien, die nach den sterblichen Überresten ihrer Vorfahren suchen – Gebeine, die während der deutschen Kolonialzeit nach Deutschland gebracht und in Museen gelagert wurden. Der Film ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen den Regisseurinnen Agnes Lisa Wegner und Cece Mlay. Ihre Arbeit macht deutlich, dass der Umgang mit der kolonialen Vergangenheit kein rein akademisches Thema ist, sondern tief in die Gegenwart reicht.
Bei der deutschlandweiten Tour zu „Das leere Grab“ kommen Cece Mlay und Felix Kaaya persönlich mit dem Publikum ins Gespräch. In Zwickau findet die Veranstaltung am 2. September im Käthe-Kollwitz-Gymnasium statt. Der Abend steht unter dem Motto: „Bleibt das Grab leer? – Über koloniale Verbrechen und Verantwortung.“
Was bedeutet der Titel „Das leere Grab“?
Diese Frage stellen sich viele Menschen, die den Titel zum ersten Mal hören. Er verweist auf das Trauma vieler afrikanischer Familien, deren Ahnen in der Kolonialzeit getötet und deren Überreste nach Europa verschleppt wurden. Ihre Gräber blieben leer – im wörtlichen wie im spirituellen Sinne. Der Verlust der körperlichen Überreste bedeutet nicht nur den Bruch familiärer Kontinuität, sondern auch die Unterbrechung spiritueller Rituale, die eng mit der Erinnerung an die Ahnen verbunden sind.
Die Protagonisten: Persönliche Geschichten, kollektive Wunden
Der Film erzählt die Geschichten zweier Familien: der Familie Mbano und der Familie Kaaya. John Mbano und seine Frau Cesilia kämpfen um die Rückführung des Schädels ihres Urgroßvaters Songea Mbano. Dieser wurde 1906 während der Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstands hingerichtet. Felix und Ernest Kaaya suchen nach den Gebeinen ihres Vorfahren Lobulu Kaaya, der sich 1900 gegen Landenteignung durch die deutsche Kolonialverwaltung gewehrt hatte und daraufhin ebenfalls getötet wurde.
„Als sein Kopf abgeschnitten und woanders hingebracht wurde, hat die gesamte Community ihre Ideen und Rituale verloren“, sagt ein Enkel der Mbano-Familie im Film. Solche Aussagen geben Einblicke in das tiefe emotionale und kulturelle Trauma, das mit dem Verlust der Vorfahren einhergeht. Die Suche nach den Gebeinen ist nicht nur ein Akt der Rückführung, sondern auch ein Versuch der Heilung.
Ein deutsch-tansanisches Filmprojekt mit politischer Relevanz
Cece Mlay, Co-Regisseurin des Films und Creative Supervisor bei Kijiweni Productions, stammt aus Dar es Salaam und bringt eine tansanische Perspektive in das Projekt. Gemeinsam mit Agnes Lisa Wegner aus Deutschland gelingt es ihr, eine gleichberechtigte Erzählweise zu etablieren. Der Film lässt ausschließlich die Betroffenen selbst zu Wort kommen – es gibt keine erklärende Stimme aus dem Off. Das erzeugt Nähe und Authentizität.
Diese Entscheidung ist bewusst: Die Regisseurinnen wollten den Raum für eine andere Erzählung schaffen – eine, die nicht von außen übergestülpt wird, sondern aus der Mitte der betroffenen Gemeinschaften heraus entsteht.
In welchen Sprachen ist „Das leere Grab“ verfügbar?
Der Film wurde in Swahili, Deutsch und Englisch gedreht. Die Vielsprachigkeit reflektiert die internationale Tragweite des Themas und macht den Film einem breiten Publikum zugänglich. Untertitel in Deutsch und Englisch sorgen für Verständlichkeit und transportieren zugleich die kulturelle Vielfalt der Beteiligten.
Zwischen Erinnerung, Verantwortung und politischer Realität
„Das leere Grab“ beleuchtet nicht nur die persönliche Ebene des Verlusts, sondern thematisiert auch die politische Verantwortung Deutschlands. Trotz öffentlicher Bekenntnisse zur Aufarbeitung kolonialer Verbrechen verlaufen Rückführungen in der Praxis oft schleppend. In vielen Fällen ist die Herkunft der Gebeine in den Archiven unzureichend dokumentiert oder umstritten. Die betroffenen Familien müssen jahrelang mit Behörden kommunizieren, Gutachten einholen und bürokratische Hürden überwinden – oft ohne Erfolg.
Die Regisseurinnen zeigen symbolische Gesten wie die Umbenennung der Petersallee in Berlin in „Anna-Mungunda-Allee“ und „Maji-Maji-Allee“ – wichtige Zeichen der Erinnerung im öffentlichen Raum. Dennoch bleibt der zentrale Wunsch vieler Betroffener nach Rückgabe und Entschuldigung bislang unerfüllt.
Wo kann „Das leere Grab“ gestreamt oder angesehen werden?
Nach seiner Premiere bei der Berlinale 2024 und der anschließenden Kinoveröffentlichung am 23. Mai 2024 war der Film ab 26. Mai 2025 auch im ZDF zu sehen. Die Online-Verfügbarkeit lief bis zum 21. August 2025. Zusätzlich ist der Film als DVD und Video-on-Demand über den Salzgeber-Verleih erhältlich. Diese breite Distribution ermöglicht es auch Bildungseinrichtungen und Initiativen, den Film für Bildungs- und Aufklärungsarbeit einzusetzen.
Reaktionen und Wirkung: Öffentlichkeit und Medien
Der Film wurde vielfach ausgezeichnet – u. a. als Bester Dokumentarfilm beim Filmfestival Baden-Württemberg 2024 und mit dem Publikumspreis beim Internationalen Filmfestival Innsbruck. 2025 erhielt er den renommierten Civis Medienpreis. In Kritiken wird besonders hervorgehoben, wie eindringlich die Erzählstruktur, die Musik und der Verzicht auf klassische Erzählerstimmen wirken. Die Erzählung setzt auf Nähe statt Distanz, auf Emotion statt Erklärung.
Welche Auszeichnungen hat „Das leere Grab“ erhalten?
- Filmpreis für den besten Dokumentarfilm (Filmfestival Baden-Württemberg 2024)
- Publikumspreis (Internationales Filmfestival Innsbruck 2024)
- Teilnahme an DOK.network Africa (DOK.fest München 2024)
- Civis Medienpreis 2025
Ein Film im Bildungs- und Aktivismuskontext
Begleitend zum Film sind bundesweit Veranstaltungen, Workshops und Schulprojekte geplant. In Tansania bringt Cesilia Mbano das Thema aktiv in den Schulunterricht ein. In Deutschland veranstaltet das Leipziger Missionswerk Dialogformate, in denen Schüler:innen, Lehrer:innen und Bürger:innen gemeinsam über koloniale Kontinuitäten diskutieren können.
In Zwickau wird der Film nicht nur gezeigt, sondern durch die Anwesenheit von Cece Mlay und Felix Kaaya lebendig vermittelt. Diese Begegnung ermöglicht einen Perspektivwechsel und sensibilisiert für eine Geschichte, die lange am Rand des öffentlichen Bewusstseins stand.
Welche Familien stehen im Zentrum des Films „Das leere Grab“?
Im Mittelpunkt stehen zwei Familien mit historischen Bezügen zur deutschen Kolonialgeschichte:
| Familie | Ahne | Hintergrund |
|---|---|---|
| Mbano | Songea Mbano | Hingerichtet 1906 im Maji-Maji-Aufstand. Schädel wurde nach Deutschland gebracht. |
| Kaaya | Lobulu Kaaya | Widerstand gegen Landenteignung, hingerichtet 1900. Gebeine nicht auffindbar. |
Film als Stimme für Erinnerung und Gerechtigkeit
Die Stärke von „Das leere Grab“ liegt in seiner emotionalen Tiefe und politischen Klarheit. Der Film dokumentiert nicht nur das koloniale Unrecht, sondern auch den langen Atem der Angehörigen, die sich nicht mit dem Vergessen abfinden. In Zeiten, in denen öffentliche Debatten über Kolonialismus und Rassismus wieder aufflammen, bietet der Film eine notwendige Perspektive jenseits abstrakter Diskurse.
„Keine Restitution ohne Dekolonisation“ – so lautet eine zentrale Forderung, die während einer Diskussionsveranstaltung zur Sprache kam. Damit ist gemeint, dass es nicht genügt, symbolisch zu handeln. Vielmehr braucht es strukturelle Veränderungen: erleichterte Visa für Forschende aus dem Globalen Süden, mehr Transparenz in Museumsarchiven, politische Entschlossenheit zur Rückgabe.
Ein Besuch mit Signalwirkung
Wenn das Filmteam von „Das leere Grab“ nach Zwickau kommt, ist das mehr als eine Kinoveranstaltung. Es ist ein Zeichen dafür, dass Erinnerung auch lokal gestaltet werden kann. Die Veranstaltung am Käthe-Kollwitz-Gymnasium verbindet Geschichte mit Gegenwart, Vergangenheit mit Verantwortung. Für Schüler:innen, Lehrer:innen und Bürger:innen ist es eine Gelegenheit, sich aus erster Hand mit einem Thema auseinanderzusetzen, das bislang kaum Platz im öffentlichen Diskurs hatte.
Der Besuch der Filmemacher:innen in Zwickau reiht sich ein in eine deutschlandweite Tour, die noch Stationen in Leipzig, Chemnitz, Hamburg, Hannover und Berlin umfasst. Überall lautet die Botschaft: Die Geschichte lebt – und mit ihr die Verantwortung, sie nicht zu verdrängen.
„Das leere Grab“ ist damit nicht nur ein Film, sondern ein gesellschaftliches Projekt – ein Appell an Empathie, Gerechtigkeit und historisches Bewusstsein. Wer ihn sieht, kann nicht mehr wegsehen.